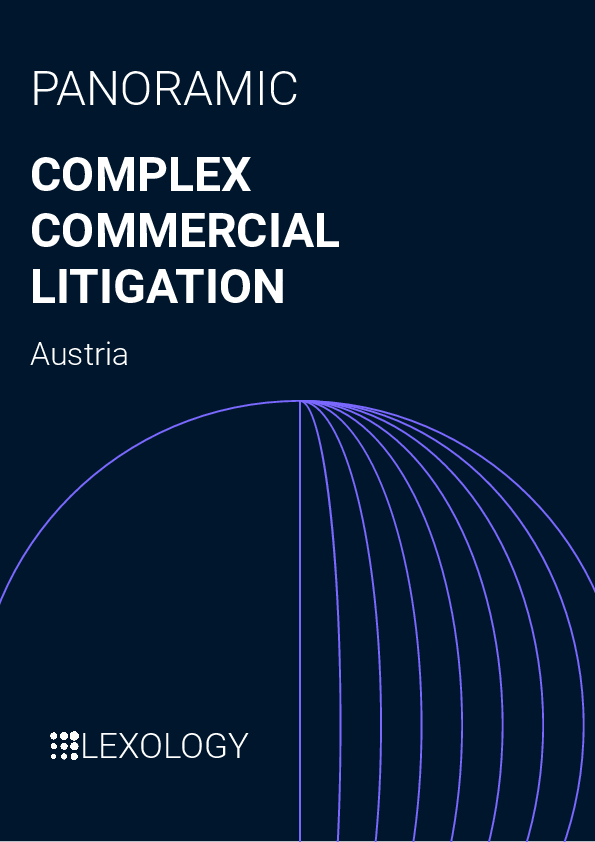Komplexe Handelsprozesse
Experten-Leitfäden: September 01, 2025
HINTERGRUND
Häufigkeit der Anwendung
Wie häufig werden Handelsstreitigkeiten als Methode zur Beilegung hochwertiger, komplexer Streitigkeiten eingesetzt? Welche Alternativen zur handelsgerichtlichen Streitbeilegung gibt es in der Regel?
In Österreich ist die handelsgerichtliche Streitbeilegung eine gängige Methode zur Beilegung von Streitigkeiten, insbesondere bei hochwertigen und komplizierten Fällen. Handelsstreitigkeiten werden durch ein gut etabliertes Verfahrenssystem und spezialisierte Handelsgerichte mit Sitz in Wien besonders unterstützt. Obwohl die Schiedsgerichtsbarkeit eine gängige Methode zur Beilegung von Streitigkeiten ist, wird neben der Schiedsgerichtsbarkeit nach wie vor häufig der Rechtsweg gewählt. Darüber hinaus ist ein Gerichtsverfahren eine bevorzugte Option, wenn ein Schiedsverfahren nicht geeignet ist oder von beiden Parteien einvernehmlich vereinbart wurde.
Recht erklärt - 30. Juli 2025
Markt für Rechtsstreitigkeiten
Bitte beschreiben Sie die Kultur und den "Markt" für Rechtsstreitigkeiten. Beteiligen sich internationale Parteien regelmäßig an Streitigkeiten vor den Gerichten in Ihrem Land oder handelt es sich dabei eher um regionale Streitigkeiten?
Der Markt für Rechtsstreitigkeiten in Österreich ist aktiv und gut entwickelt, wobei Wien als zentraler Austragungsort für Handelsstreitigkeiten dient. Obwohl viele Fälle eher regionaler Natur sind, nehmen auch internationale Parteien regelmäßig an Handelsstreitigkeiten vor österreichischen Gerichten teil, insbesondere wenn österreichisches Recht auf den Vertrag anwendbar ist oder wenn österreichische Gerichte als Gerichtsstand für den Streitfall bestimmt sind.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Rechtlicher Rahmen
Welcher rechtliche Rahmen gilt für Handelsstreitigkeiten? Unterliegt Ihr Rechtsgebiet dem Zivilgesetzbuch oder dem Common Law? Welche praktischen Auswirkungen hat dies?
Österreich hat ein zivilrechtliches System, wobei Handelsstreitigkeiten durch einen vielschichtigen Rechtsrahmen geregelt werden. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist die Zivilprozessordnung (ZPO) von zentraler Bedeutung, die das Gerichtsverfahren und die Zuständigkeit regelt. Das österreichische Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) bildet die Grundlage für das Vertrags- und Deliktsrecht und wird durch das Handelsgesetzbuch (UGB) für bestimmte Geschäftsvorgänge und Unternehmen ergänzt.
Zu den praktischen Auswirkungen eines zivilrechtlichen Rahmens gehören Gerichtsverfahren, die im Vergleich zu Common-Law-Systemen, bei denen mündliche Verhandlungen und Schwurgerichtsverfahren im Vordergrund stehen, eher formal und dokumentenorientiert sind. Außerdem spielen die Richter vor Gericht eine inquisitorische Rolle, anstatt sich darauf zu verlassen, dass die Parteien kontradiktorisch Beweise vorlegen. Und schließlich beruhen Rechtsentscheidungen meist auf gesetzlichen Bestimmungen, was Vorhersehbarkeit und Kohärenz fördert.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Einreichung einer Klage - erste Überlegungen
Zu beachtende Schlüsselfragen
Welche wichtigen Punkte sollte eine Partei vor der Klageerhebung bedenken?
Bevor die Parteien eine Klage bei einem österreichischen Gericht einreichen, sollten sie bestimmte Faktoren sorgfältig prüfen.
Erstens sollten die Parteien die voraussichtlichen Kosten abschätzen, die bei der Einleitung eines Gerichtsverfahrens anfallen werden. Faktoren wie die Langwierigkeit des Verfahrens und die Gewinnchancen sollten geprüft werden. Oft ist es sinnvoll, diese vorläufigen Kosten mit denen zu vergleichen, die bei einer möglichen Beilegung der Streitigkeit durch ein Schiedsverfahren anfallen würden.
Da es in Österreich keine vorprozessuale Offenlegung gibt, müssen die Kläger sicherstellen, dass alle relevanten Beweise vor Einleitung des Verfahrens gesichert sind. Im Gegensatz zu anderen Rechtsordnungen, in denen die Parteien vor der Verhandlung Dokumente oder Informationen von der Gegenseite anfordern können, liegt nach österreichischem Recht die volle Verantwortung für die Beweiserhebung beim Kläger. Das bedeutet, dass wichtige Beweise, die nicht vor Einreichung der Klage beschafft wurden, später im Verfahren nur schwer oder gar nicht vorgelegt werden können, was die Position des Klägers schwächen könnte.
Schließlich ist auch die Berücksichtigung der Verjährungsfristen in Österreich von wesentlicher Bedeutung. Nach österreichischem Recht beginnt die Verjährungsfrist im Allgemeinen mit dem Zeitpunkt, zu dem der betreffende Anspruch erstmals geltend gemacht werden konnte. Die lange Verjährungsfrist beträgt 30 Jahre und gilt standardmäßig, sofern nicht besondere Bestimmungen etwas anderes vorsehen. Die kurze Verjährungsfrist beträgt in der Regel drei Jahre und gilt für bestimmte Ansprüche wie Forderungen und Schadensersatzansprüche. Wird ein Verfahren nicht innerhalb der geltenden Verjährungsfristen eingeleitet, so geht das Recht auf Rechtsverfolgung verloren.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Anforderungen an das vorprozessuale Verhalten
Gibt es Anforderungen an das vorprozessuale Verhalten und was sind die Folgen bei Nichteinhaltung?
Nein, es gibt keine Anforderungen an das vorprozessuale Verhalten, die in Österreich erfüllt werden müssen.
Stand des Gesetzes - 30. Juli 2025
Begründung der Zuständigkeit
Wie wird die Zuständigkeit begründet?
In Österreich wird die Zuständigkeit durch einen mehrstufigen Rahmen begründet, der mit der Prüfung der internationalen, sachlichen (ratione materiae) und territorialen (ratione loci) Zuständigkeit des Gerichts von Amts wegen beginnt. Bei den sachlichen Zuständigkeitsregeln wird zwischen den einzelnen Gerichtsebenen unterschieden: Die Bezirksgerichte sind für zivilrechtliche Ansprüche bis zu 15 000 Euro sowie für bestimmte familien- und mietrechtliche Streitigkeiten zuständig, während die Landgerichte für Streitigkeiten über 15 000 Euro, Handelssachen, Arbeitsrecht, Sozialrecht und geistiges Eigentum zuständig sind. Für ausländische Parteien richtet sich die internationale Zuständigkeit in erster Linie nach dem Wohnsitz des Beklagten: Liegt dieser in einem EU-Mitgliedstaat, gelten EU-Verordnungen wie die Brüssel-I-Neufassungsverordnung; andernfalls ist das österreichische Gerichtsstandsgesetz anwendbar. Während die allgemeine Regel die Zuständigkeit am Wohnsitz oder Sitz des Beklagten vorsieht, sehen das österreichische Recht und die EU-Verordnungen auch zahlreiche besondere oder wahlfreie Gerichtsstände (z.B. Erfüllungsort, Ort der unerlaubten Handlung) und bestimmte ausschließliche oder zwingende Gerichtsstände (z.B. Immobilien, Verbraucherverträge, bei denen die Zuständigkeit typischerweise auf den Wohnsitz des Verbrauchers beschränkt ist) vor.
Die Anfechtung der gerichtlichen Zuständigkeit ist allgemein möglich und wird im Laufe des Verfahrens geprüft. Ein Beklagter kann die Zuständigkeit eines Gerichts mit dem Hinweis auf fehlende internationale, sachliche oder territoriale Zuständigkeit oder, was entscheidend ist, auf das Bestehen einer Schiedsvereinbarung einwenden, die bei Verbrauchern in einem gesonderten Dokument nach Entstehen der Streitigkeit geschlossen werden muss. Um zu verhindern, dass ein Beklagter ein sich überschneidendes Verfahren in einem bevorzugten ausländischen Gerichtsstand einleitet, wenden die österreichischen Gerichte im Einklang mit dem EU-Recht die Rechtshängigkeitsregeln gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Brüssel-la-Verordnung an. Die Brüssel I-Neufassung und das Lugano-Übereinkommen schreiben vor, dass ein angerufenes Gericht sein Verfahren grundsätzlich aussetzen muss, wenn ein Gericht in einem anderen Vertragsstaat wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien früher angerufen wurde. Österreichische Gerichte erlassen jedoch in der Regel keine einstweiligen Verfügungen, da diese im Allgemeinen als unvereinbar mit den Grundsätzen des gegenseitigen Vertrauens und der unmittelbaren Anwendbarkeit von Urteilen nach EU- und internationalen Rechtsinstrumenten angesehen werden.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Anwendbarkeit von ausländischem Recht
Unter welchen Umständen wenden die Gerichte ausländisches Recht an, um Fragen zu klären, die vor ihnen verhandelt werden?
Österreichisches Recht ist standardmäßig anwendbar, wenn beide Parteien ihren Wohnsitz in Österreich haben und kein ausländisches Element vorliegt. In Angelegenheiten, an denen EU-Parteien beteiligt sind, regeln die Verordnungen Rom I und II das anwendbare Recht für vertragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse. Diese Instrumente respektieren im Allgemeinen die Autonomie der Parteien bei der Wahl des anwendbaren Rechts. In Ermangelung einer gültigen Rechtswahl wenden die Gerichte das Recht des Landes an, in dem die Leistung erbracht wurde (Rom-I-Verordnung) oder in dem der Schaden eingetreten ist (Rom-II-Verordnung).
In den Fällen, in denen die EU-Instrumente nicht anwendbar sind, wie z.B. in bestimmten gesellschaftsrechtlichen oder personenstandsrechtlichen Angelegenheiten, ergänzt das österreichische Gesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) den Rahmen. So bestimmt das IPRG beispielsweise das anwendbare Recht für juristische Personen auf der Grundlage des Prinzips des "tatsächlichen Sitzes".
Die Anwendung ausländischen Rechts in Österreich kann zu einem taktischen Vorteil genutzt werden, vor allem bei der Wahl des anwendbaren Rechts in Verträgen oder bei der Vollstreckung eines ausländischen Urteils. Eine Partei könnte strategisch das für ihre Position günstige ausländische Recht wählen oder argumentieren, dass ausländisches Recht anzuwenden ist, auch wenn österreichisches Recht für die andere Partei vorteilhafter wäre. Allerdings können Ausnahmen von der öffentlichen Ordnung (ordre public) die Anwendung des ausländischen Rechts außer Kraft setzen.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Einfrieren von Vermögenswerten
Wann sollte ein Kläger eine Anordnung zum Einfrieren des Vermögens des Beklagten erwägen? Was sind die Voraussetzungen und andere Überlegungen?
In Österreich sollte ein Kläger eine Sicherstellungsentscheidung in Erwägung ziehen, wenn ein glaubhaftes Risiko besteht, dass die Vollstreckung eines Urteils erheblich gefährdet wäre. Nach dem österreichischen Vollstreckungsgesetz umfasst dies eine einstweilige Verfügung für nichtmonetäre Ansprüche oder eine vorgerichtliche Pfändung für Geldforderungen,
Zu den Voraussetzungen für derartige Anordnungen gehören die Glaubhaftmachung eines Anspruchs und eine konkrete Gefahr der Vermögensverschleuderung oder -verschleierung (z. B. Wegnahme von Vermögenswerten, Gefahr der Insolvenz). Die Gerichte wenden diese Maßnahmen häufig im Wege eines beschleunigten Ex-parte-Verfahrens an, können jedoch vom Antragsteller verlangen, eine Kaution zu hinterlegen, um den Antragsgegner für mögliche Schäden zu entschädigen, falls sich die Anordnung später als ungerechtfertigt erweist. Zu den strategischen Überlegungen der Antragsteller gehören die Bewertung der Beweiskraft der Gefährdung, der Umfang des pfändbaren Vermögens und die verschuldensunabhängige Haftung für unrechtmäßige Verfügungen.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Sonstiger einstweiliger Rechtsschutz
Welche anderen Formen des einstweiligen Rechtsschutzes können beantragt werden?
Formen des einstweiligen Rechtsschutzes sind vor allem einstweilige Verfügungen, die einen drohenden, unwiederbringlichen Schaden abwenden und die Wirksamkeit künftiger Urteile sicherstellen sollen.
Diese einstweiligen Verfügungen lassen sich im Allgemeinen in drei Kategorien einteilen:
- Sicherung von Geldansprüchen, z. B. durch Einfrieren von Vermögenswerten, Verbot von Verkäufen oder Belastungen und Zurückhaltung von Zahlungen Dritter;
- Sicherung von Ansprüchen auf bestimmte Leistungen durch Erzwingen oder Verbieten von Handlungen, die die Rechte des Klägers beeinträchtigen, und Schutz von Rechten oder Rechtsverhältnissen; und
- Unterlassungs- oder Zwangsverfügungen in Bereichen wie geistiges Eigentum oder unlauterer Wettbewerb.
Allen Formen der einstweiligen Verfügung gemeinsam sind die Voraussetzungen eines glaubhaften Anscheinsbeweises und einer nachweisbaren Gefährdung, die ein sofortiges gerichtliches Eingreifen erfordert. Auch wenn die einstweilige Verfügung häufig ex parte erlassen wird, können die Gerichte vom Antragsteller eine Sicherheitsleistung verlangen, die für alle Schäden haftet, die dem Antragsgegner entstehen, wenn sich die einstweilige Verfügung später als ungerechtfertigt erweist. Eine Kaution kann zur Deckung potenzieller Schäden angeordnet werden, da der Antragsteller die verschuldensunabhängige Haftung übernimmt, wenn sich die einstweilige Verfügung als unbegründet erweist. Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sind in der Regel schnell und vertraulich und erfordern bei einem Streitwert von über 5.000 € eine anwaltliche Vertretung.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Alternative Streitbeilegung
Verlangt oder erwartet das Gericht von den Parteien, dass sie sich in der Phase vor der Klage oder im weiteren Verlauf des Verfahrens an einer alternativen Streitbeilegung beteiligen? Welche Folgen hat es, wenn sie sich in diesen Phasen nicht an der alternativen Streitbeilegung beteiligen?
Die österreichischen Gerichte verlangen von den Parteien im Allgemeinen nicht, dass sie sich in der Phase vor der Klage oder später im Verfahren an einer alternativen Streitbeilegung (ADR) beteiligen. Die Teilnahme an ADR ist den Parteien selbst überlassen. Artikel 257 der österreichischen Zivilprozessordnung sieht jedoch vor, dass der Richter die Parteien bei der ersten Verhandlung auf die Möglichkeit einer Einigung hinweist. Sind die Parteien mit der Inanspruchnahme von ADR einverstanden, wird der Richter in der Regel versuchen, direkt in dieser ersten Verhandlung eine Einigung herbeizuführen. Dies spiegelt einen gerichtlichen Ansatz zur Streitbeilegung wider, auch wenn die Teilnahme an einer formellen Mediation außerhalb des Gerichtssaals fakultativ bleibt.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Ansprüche gegen natürliche Personen und Unternehmen
Gibt es bei Klagen gegen natürliche Personen andere Erwägungen als bei Klagen gegen Kapitalgesellschaften?
Während sowohl natürliche als auch juristische Personen die Rechtsfähigkeit besitzen, um verklagt zu werden, sind bei Klagen gegen juristische Personen in der Regel zusätzliche Verfahrensschritte erforderlich. Dazu gehören die Identifizierung der gesetzlichen Vertreter des Unternehmens, die Bestimmung des eingetragenen Sitzes und häufig die Einholung eines Handelsregisterauszugs zur Überprüfung der offiziellen Angaben. Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied ist die Zustellung von Rechtsdokumenten: Während natürliche Personen an ihrem Wohnsitz zugestellt werden, erfolgt die Zustellung bei Kapitalgesellschaften an ihrer eingetragenen Geschäftsadresse.
Auch die Haftungsstrukturen unterscheiden sich erheblich. Kapitalgesellschaften, wie z. B. eine GmbH oder eine AG, sind unabhängige juristische Personen und haften mit ihrem eigenen Namen, getrennt von ihren Aktionären oder Geschäftsführern. Im Gegensatz dazu haften bestimmte Personengesellschaften, insbesondere offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, mit der persönlichen Haftung eines oder mehrerer Gesellschafter.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Sammelklagen
Gibt es Unterschiede bei Sammelklagen, Mehrparteienklagen oder Gruppenklagen?
In Österreich gibt es kein traditionelles Sammelklagesystem. Stattdessen werden Rechtsstreitigkeiten mit mehreren Parteien hauptsächlich nach dem "österreichischen Modell" geführt, bei dem Einzelpersonen ihre Ansprüche an einen Dritten abtreten (österreichische Zivilprozessordnung). Bei diesem Modell wird vor allem darauf geachtet, dass die Ansprüche in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, in Bezug auf den Gerichtsstand, die Art des Verfahrens und den Klagegrund ähnlich sind.
Im Jahr 2024 hat Österreich die Richtlinie (EU) 2020/1828 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher (RAD) umgesetzt. Diese Richtlinie ermöglicht es qualifizierten Einrichtungen, sowohl Unterlassungs- als auch Schadenersatzklagen zu erheben, wobei die Zustimmung der Verbraucher obligatorisch ist. Ein wichtiger Gesichtspunkt für solche Sammelklagen ist, dass ein Zusammenhang zwischen den Ansprüchen besteht (z. B. vergleichbare Rechtsfragen).
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Finanzierung durch Dritte
Welche Einschränkungen gibt es für Dritte, die die Kosten des Rechtsstreits finanzieren oder sich bereit erklären, nachteilige Kosten zu übernehmen?
In Österreich gibt es keine formellen Beschränkungen für die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten durch Dritte. Im Jahr 2013 hat der Oberste Gerichtshof (OGH) die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten durch Dritte genehmigt (6 Ob 224/12b).
Es gibt jedoch spezifische Regeln für Gebühren und Zinsen, die Geldgeber verlangen können, und Rechtsanwälte müssen sicherstellen, dass ihr berufliches Verhalten nicht gegen diese Regeln verstößt. Gemäß § 16 der Rechtsanwaltsordnung und § 879 II des österreichischen Bürgerlichen Gesetzbuches ist eine Finanzierungsvereinbarung, die direkt oder indirekt zu einem Erfolgshonorarmodell führt, verboten. Darüber hinaus darf die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten durch Dritte keine Gewinnerzielungsabsicht beinhalten.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Erfolgshonorarvereinbarungen
Können Anwälte auf Erfolgshonorarbasis tätig werden? Welche Möglichkeiten gibt es? Was ist zu beachten, bevor eine solche Vereinbarung getroffen wird?
Österreichischen Rechtsanwälten ist es untersagt, ein Erfolgshonorar zu vereinbaren, bei dem sie einen Prozentsatz des Erlöses erhalten (pactum de quota litis). Bedingte Honorarvereinbarungen, bei denen der Anwalt im Erfolgsfall einen höheren Stundensatz oder einen Bonus erhält, sind zulässig. Damit diese Vereinbarung rechtmäßig ist, muss jedoch ein Mindesthonorar wie ein Pauschalhonorar oder ein Stundensatz vereinbart werden.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Die Klage
Geltendmachung von Ansprüchen
Wie werden Ansprüche geltend gemacht? Wie sind die Schriftsätze aufgebaut, und wie lang sind sie in der Regel? Welche Unterlagen müssen dem Schriftsatz beigefügt werden?
Klagen in Handelssachen werden eingeleitet, indem zunächst eine Klageschrift beim Gericht der ersten Instanz eingereicht wird. In der Klageschrift müssen der Sachverhalt, die Beweismittel und das Klagebegehren dargelegt werden. Sobald die Klageschrift bei Gericht eingegangen ist, gilt die Klage als offiziell eingereicht.
Die Schriftsätze sind so aufgebaut, dass sie die tatsächliche und rechtliche Grundlage des Anspruchs klar umreißen, wobei der Umfang des Schriftsatzes in der Regel 10-30 Seiten beträgt, aber von Fall zu Fall variiert. Zu den Unterlagen, die dem Schriftsatz beigefügt werden müssen, gehören alle Dokumente, die den Anspruch untermauern, wie z. B. Verträge, Jahresabschlüsse und alle Beweise, die den Anspruch stützen könnten.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Zustellung von Forderungen an ausländische Parteien
Wie werden Forderungen an ausländische Parteien zugestellt?
Für die Zustellung von Forderungen an Beklagte mit Wohnsitz in der EU gilt in der Regel die Verordnung (EU) 2020/1784. Mit dieser Verordnung wird ein System der direkten Übermittlung zwischen benannten Übermittlungs- und Empfangsstellen in den Mitgliedstaaten eingeführt, das häufig eine Zustellung per Post oder durch Gerichtsvollzieher ermöglicht. Für Parteien in Nicht-EU-Staaten sieht das Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen die Übermittlung der Zustellung vor. In Ermangelung solcher Übereinkommen kann die Zustellung auf bilateralen Verträgen oder auf diplomatischem Weg erfolgen.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Wichtigste Klagegründe
Welches sind die wichtigsten Klagegründe, die typischerweise bei Rechtsstreitigkeiten in Handelssachen auftreten?
Die wichtigsten Klagegründe, die typischerweise bei handelsrechtlichen Streitigkeiten auftreten, sind Gesellschafterstreitigkeiten, Streitigkeiten über geistiges Eigentum sowie Vertragsverletzungen.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Änderungen von Ansprüchen
Unter welchen Umständen können Änderungen an den Ansprüchen vorgenommen werden?
Gemäß Artikel 235 der Zivilprozessordnung sind Änderungen der Klage im Allgemeinen zulässig, bevor die Klage dem Beklagten zugestellt wird. Nach der Zustellung der Klage sind Änderungen mit Zustimmung des Beklagten oder mit Genehmigung des Gerichts noch bis zum Ende des erstinstanzlichen Verfahrens möglich.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Rechtsbehelfe
Welche Rechtsbehelfe stehen einem Kläger in Ihrem Rechtssystem zur Verfügung?
Klägern steht eine Reihe von Rechtsbehelfen zur Verfügung, um Verpflichtungen durchzusetzen, Unrecht zu verhindern oder Rechtspositionen zu klären. Dazu gehören die Durchsetzung der Erfüllung von Vereinbarungen, die Erwirkung von einstweiligen Verfügungen, um rechtswidriges Verhalten zu unterbinden, die Beantragung von Feststellungsurteilen zur Klärung von Rechten oder die Geltendmachung von Schadenersatz. Darüber hinaus kann ein gerichtliches Eingreifen zur Schaffung oder Änderung eines Rechtsstatus beantragt werden. Ein grundlegendes Prinzip des Schadenersatzes ist sein kompensatorischer Charakter; Strafschadensersatz ist nicht zulässig, da es ausschließlich um die Wiedergutmachung des tatsächlich erlittenen Schadens geht (§ 1323 ABGB).
Beim Schadenersatz geht es in erster Linie um die Wiederherstellung des Zustandes vor dem Schaden oder um eine Geldentschädigung, wenn die Wiederherstellung in natura nicht möglich ist. Der Umfang des Schadenersatzes in Geld hängt vom Verschulden des Beklagten ab: Während bei leichter Fahrlässigkeit in der Regel nur der tatsächliche Schaden ersetzt wird, ist bei grober Fahrlässigkeit voller Schadenersatz zu leisten, der auch den entgangenen Gewinn einschließt. Unter Unternehmern ist der volle Schadenersatz sogar bei leichter Fahrlässigkeit fällig. Immaterielle Schäden, wie z. B. Rufschädigung, sind weitgehend nicht ersatzfähig, abgesehen von bestimmten gesetzlichen Ausnahmen wie Schmerzensgeld oder entgangene Urlaubsfreuden. Neuere Auslegungen, die durch die Allgemeine Datenschutzverordnung beeinflusst wurden, berücksichtigen emotionale Beeinträchtigungen. Darüber hinaus können die Parteien Vertragsstrafen vereinbaren, um die Erfüllung zu fördern und die Ansprüche zu vereinfachen; diese sind unabhängig vom tatsächlichen Schaden fällig, unterliegen der richterlichen Mäßigung und ermöglichen über die Vertragsstrafe hinausgehende Ansprüche zwischen Unternehmern.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Erstattungsfähige Schäden
Welche Schäden sind erstattungsfähig? Gibt es besondere Regeln für den Schadensersatz, die diese Rechtsprechung günstiger machen als andere?
Der ersatzfähige Schadenersatz zielt auf eine vollständige Entschädigung ab, die den Geschädigten in die Lage versetzt, in der er sich vor dem schädigenden Ereignis befunden hat (§§ 1293-1320 ABGB), wobei eine Geldentschädigung zuerkannt wird, wenn eine Rückerstattung nicht möglich ist. Zu den wichtigsten Schadenersatzkategorien gehören der tatsächliche Schaden, der unmittelbare finanzielle Verluste und entgangene Gewinne abdeckt, die typischerweise einen höheren Verschuldensgrad (grobe Fahrlässigkeit/Absatz) für den Ersatz erfordern. Das österreichische Recht lässt keine Strafschadensersatzansprüche zu und konzentriert sich ausschließlich auf Ausgleichszwecke. Voraussetzung für die Geltendmachung von Schadenersatz ist der Nachweis des Schadens, der adäquaten Kausalität, der Rechtswidrigkeit oder des Verstoßes und des Verschuldens.
Das österreichische Schadenersatzrecht kann aufgrund der strengen Beweisanforderungen, des Fehlens von Strafschadenersatz und des Kostenrisikos für die Kläger die Beklagten begünstigen. In Bereichen mit verschuldensunabhängiger Haftung (z. B. bei Produkt- oder Nuklearschäden) können Kläger jedoch von einer günstigen Haftungsstruktur und dem Fehlen von Schadensobergrenzen profitieren.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Reagieren auf den Anspruch
Frühzeitige Schritte möglich
Welche Schritte stehen dem Beklagten in der Anfangsphase eines Verfahrens offen?
Zunächst hat der Beklagte vier Wochen Zeit, um eine Klageerwiderung ab dem Tag der Zustellung einzureichen, in der er alle Tatsachen und Beweismittel darlegt und einen bestimmten Antrag stellt. Die Klageerwiderung kann auch Einwendungen gegen die Zuständigkeit des Gerichts enthalten, z. B. mangelnde internationale, sachliche oder territoriale Zuständigkeit, die in diesem frühen Stadium geltend gemacht werden müssen, um als gültig zu gelten. Der Beklagte kann eine Widerklage erheben, die sich entweder auf die ursprüngliche Klage bezieht oder eine eigenständige Klage darstellt. Diese Widerklage muss jedoch ebenfalls innerhalb von vier Wochen eingereicht werden.
Ist der Beklagte der Ansicht, dass ein Dritter (ganz oder teilweise) für die Forderung des Klägers haftet, kann er diesen Dritten in den Prozess einbeziehen. Auf diese Weise kann der Dritte dem Verfahren als Partei beitreten und möglicherweise einen Beitrag zur Forderung leisten oder für einen Beitrag oder eine Entschädigung haften.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Struktur der Verteidigung
Wie sind die Klageerwiderungen aufgebaut und müssen sie innerhalb bestimmter Fristen zugestellt werden? Welche Dokumente müssen der Verteidigung beigefügt werden?
Die Klageerwiderung ist als förmliche Antwort auf die Forderung zu gestalten, in der der Beklagte seinen tatsächlichen und rechtlichen Standpunkt zum Bestreiten der Forderung darlegt, und muss innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Forderung eingereicht werden (österreichische Zivilprozessordnung (ZPO)).
Der Beklagte muss der Klageerwiderung alle Unterlagen beifügen, die seine Verteidigung mit Beweisen untermauern. Wird die vierwöchige Frist nicht eingehalten oder die Klageerwiderung nicht ordnungsgemäß aufgebaut, kann dies zu einem Versäumnisurteil führen.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Änderung der Verteidigung
Unter welchen Umständen kann ein Beklagter seine Verteidigung in einem späteren Stadium des Verfahrens ändern?
Ein Beklagter kann seine Verteidigung nur dann ändern, wenn alle beteiligten Parteien damit einverstanden sind. Aber auch wenn die Parteien nicht zustimmen, kann das Gericht nachträgliche Änderungen zulassen, wenn die Änderung die anderen Parteien nicht benachteiligt und das Verfahren nicht wesentlich verzögert.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Gemeinsame Haftung
Wie kann ein Beklagter die Abwälzung oder Teilung der Haftung nachweisen?
Ein Beklagter kann die Haftung abwälzen oder teilen, indem er nachweist, dass er nicht allein für den Schaden verantwortlich ist und dass eine andere Partei zum Entstehen des Schadens beigetragen hat. Der Beklagte müsste nachweisen, dass ein Dritter beteiligt war oder dass der Schaden vollständig von einer bestimmten Person oder mehreren Personen verursacht wurde, die nicht der Beklagte sind.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Prozessvermeidung
Wie kann ein Beklagter einen Prozess vermeiden?
In Österreich kann ein Beklagter ein Gerichtsverfahren durch verschiedene Mittel vermeiden, z. B:
Vergleich: Wenn eine Vereinbarung zwischen den beteiligten Parteien ausgehandelt wird, kann der Streit beigelegt und eine Gerichtsverhandlung vermieden werden.
Antrag auf Klageabweisung: Mit einem Antrag auf Klageabweisung wird geltend gemacht, dass die Klage wegen Rechtsmängeln (z. B. Mängel bei der Einreichung der Klage) nicht berücksichtigt werden sollte.
Anfechtung der Zuständigkeit: Wenn der Beklagte argumentiert, dass das Gericht für den Fall nicht zuständig ist, kann er dies anfechten und möglicherweise erreichen, dass der Fall abgewiesen oder an das zuständige Gericht verwiesen wird.
Widerklage: Der Beklagte kann eine Widerklage gegen den Kläger einreichen und seine eigene Forderung in denselben Fall einbringen. Diese Widerklage kann den Schwerpunkt des Falles verlagern und möglicherweise zu einem Vergleich oder zur Abweisung des Falles führen.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Fall der fehlenden Verteidigung
Was geschieht bei Nichterscheinen oder wenn keine Verteidigung angeboten wird?
Erscheint der Beklagte nicht zur ersten Verhandlung oder reicht er nicht rechtzeitig eine Klageerwiderung ein, kann der Kläger beim Gericht ein Versäumnisurteil beantragen. Das Gericht wird dann den vom Kläger beantragten Rechtsbehelfen stattgeben, es sei denn, es hält sie für unangemessen oder unverhältnismäßig. Versäumnisurteile ermöglichen eine rasche Beilegung einer Klage, wenn der Beklagte sich nicht am Verfahren beteiligt.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Beantragung einer Sicherheit
Kann ein Beklagter eine Sicherheit für die Kosten verlangen? Wenn ja, welche Form der Sicherheit kann geleistet werden?
Ein Beklagter kann von einem ausländischen Kläger gemäß § 57 Absatz 1 ZPO eine Sicherheit für die Kosten verlangen. Dieser Mechanismus gewährleistet die Vollstreckbarkeit möglicher Kostenzusprüche gegen Kläger, die ihren Wohnsitz nicht in Österreich haben, und kein Staatsvertrag oder eine EU-Verordnung gewährleistet die gegenseitige Vollstreckung von Kosten. Die Höhe der Kosten richtet sich nach den voraussichtlichen Verfahrenskosten des Beklagten, mit Ausnahme der Kosten für Widerklagen. Als Sicherheiten werden in der Regel Bareinlagen, Bankgarantien oder Treuhandzahlungen akzeptiert, um die Kosten des Beklagten zuverlässig abzusichern. Kläger aus EU/EWR-Mitgliedsstaaten oder Ländern mit Vollstreckbarkeitsvereinbarungen sind jedoch in der Regel von solchen Anordnungen ausgenommen.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Fortschreiten des Verfahrens
Typische Verfahrensschritte
Wie sieht die typische Abfolge von Verfahrensschritten in Handelsstreitigkeiten in diesem Land aus?
In Österreich folgen handelsrechtliche Streitigkeiten einem strukturierten Verfahren, das in der österreichischen Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt ist. Die typische Abfolge von Verfahrensschritten in Handelsstreitigkeiten ist wie folgt:
- Einreichung einer Klageschrift;
- Zustellung der Klage;
- Klagebeantwortung/Einrede;
- vorbereitende Anhörung;
- Beweisanhörung;
- Urteil;
- Rechtsmittel; und
- Vollstreckung.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Hinzuziehung weiterer Parteien
Können zusätzliche Parteien in ein Verfahren einbezogen werden, nachdem es begonnen hat?
Ja, nach österreichischem Recht können weitere Parteien zu einem Verfahren hinzugezogen werden, auch nachdem es bereits begonnen hat. Dies kann auf folgende Weise geschehen.
Prinzipielle Intervention
Gemäß § 16 ZPO kann jeder Dritte, der einen Anspruch auf den Gegenstand eines anhängigen Rechtsstreits zwischen zwei Parteien hat, beide Parteien gemeinsam bis zur rechtskräftigen Entscheidung verklagen.
Akzessorische Intervention
Nach § 17 ZPO kann jeder Dritte, der ein rechtliches Interesse am Erfolg einer Partei hat, dieser Partei im laufenden Rechtsstreit beitreten.
Nach § 21 ZPO kann eine Partei einen Dritten benachrichtigen, wenn:
- der Ausgang des Rechtsstreits ihre Rechtsstellung beeinträchtigen könnte; oder
- dieser Dritte später entschädigungspflichtig sein kann (z. B. bei Gewährleistungsansprüchen).
Der benachrichtigte Dritte kann sich dann freiwillig anschließen. Die Streitverkündung muss nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen, sondern vor dem Abschluss des Verfahrens.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Zusammenlegung von Verfahren
Kann ein Verfahren zusammengelegt oder geteilt werden?
Nach österreichischem Recht ist es möglich, Verfahren je nach den Umständen zusammenzulegen oder zu teilen. Eine Methode der Zusammenlegung ist in den §§ 11 und 14 ZPO als "Parteiverbindungen" geregelt, die auch als subjektive Verbindung bezeichnet wird. Die Verbindung von Parteien dient u.a. der Verfahrensökonomie und der Entscheidungskohärenz, indem sie die Duplizierung von Parallelverfahren verhindert. Es gibt zwei Arten der subjektiven Verbindung:
- Die einfache Verbindung (materiell oder formell), bei der jede Partei unabhängig handelt und getrennte Urteile ergehen können. Die materielle Klageverbindung liegt vor, wenn die Parteien Ansprüche aus demselben Sachverhalt haben (z. B. Miteigentümer einer Liegenschaft, die von einem Mieter teilweise auf Schadenersatz für Investitionen in eine Mietwohnung verklagt werden[OGH 3 Ob 590/89]), in einem gemeinsamen Rechtsverhältnis stehen (z. B. Miteigentümer oder Miterben) oder gemeinsame Rechte oder Pflichten haben (z. B. neben einem vertraglichen Schadenersatzanspruch haftet ein Dritter, z. B. ein Erfüllungsgehilfe, auch aus unerlaubter Handlung auf Ersatz desselben Schadens[OGH 3Ob514/94(3Ob515/94)]). Eine formelle Verbindung liegt vor, wenn gleichartige Ansprüche mit ähnlichem Sachverhalt geltend gemacht werden.
- Einheitliche Verbindung, bei der alle verbundenen Parteien als eine Einheit behandelt werden und das Gericht ein für alle verbindliches Urteil erlässt. Dies ist typisch, wenn das Urteil alle Parteien in gleicher Weise rechtlich betrifft (z. B. bei einer von der Staatsanwaltschaft erhobenen Klage auf Ungültigerklärung einer Ehe).
Eine weitere Möglichkeit ist die in § 227 ZPO geregelte objektive Klageverbindung. Hat ein Kläger mehrere Ansprüche gegen denselben Beklagten, können die Fälle vom Gericht zusammengelegt werden, sofern das Gericht zuständig ist und die Ansprüche der gleichen Verfahrensart unterliegen.
Das Gericht kann beschließen, verschiedene Verfahren zusammenzulegen, um die Erledigung der Fälle zu vereinfachen oder zu beschleunigen oder die Prozesskosten zu senken, wenn es sich um dieselben Parteien handelt oder wenn eine Partei verschiedenen Klägern oder Beklagten gegenübersteht. Es kann auch anordnen, dass über mehrere in demselben Rechtsstreit erhobene Ansprüche getrennt verhandelt wird (ZPO 187-188).
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Verteilung der Fälle
Wie werden die Fälle zugewiesen? Werden die Fälle einem bestimmten Richter zugewiesen? Wenn ja, in welchem Stadium?
In Österreich richtet sich die Zuweisung von Rechtssachen an die Richter im Allgemeinen nach dem Geschäftsverteilungsplan, der von den einzelnen Gerichten aufgestellt und geregelt wird.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Gerichtliche Entscheidungsfindung
Wie entscheidet ein Gericht, ob die Ansprüche oder Behauptungen bewiesen sind? Welche Elemente sind für eine positive Entscheidung erforderlich, und wie hoch ist die Beweislast?
Im österreichischen Zivilprozess entscheidet das Gericht nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (§ 272 ZPO), ob die Ansprüche bewiesen sind. Die Arten der zulässigen Beweismittel sind nicht abschließend aufgezählt, aber zu den traditionell anerkannten Formen gehören Zeugenaussagen, Urkunden, Parteivernehmung, Sachverständigengutachten, Besichtigung von Gegenständen oder Orten.
Grundsätzlich hat jede Partei die Pflicht, die tatsächlichen Voraussetzungen der Rechtsnorm, auf die sie sich beruft, zu beweisen. In Ausnahmefällen kann sich die Beweislast jedoch auf die andere Partei verlagern, wenn eine Seite unverhältnismäßig große Schwierigkeiten hat, ihren Fall zu beweisen.
In den folgenden Fällen gibt es Ausnahmen von der Beweislast:
- Zugelassene Tatsachen: Wenn die Tatsachen von der gegnerischen Partei im Verfahren oder im Schriftsatz ausdrücklich zugegeben werden (§ 266 ZPO) oder wenn die Tatsachen stillschweigend zugegeben werden (§ 267 ZPO), ist kein Beweis erforderlich.
- Offensichtliche Tatsachen (§ 269 ZPO).
- Gesetzlich vorausgesetzte Tatsachen (§ 270 ZPO).
- Verzicht auf das Beweisverfahren durch das Gericht: Steht fest, dass einer Partei ein Anspruch zusteht, dessen genaue Höhe aber nur schwer oder gar nicht zu beweisen ist, kann das Gericht den Betrag nach eigenem Ermessen schätzen, auch ohne vollen Beweis (§ 273 ZPO).
Recht erklärt - 30. Juli 2025
Wie entscheidet das Gericht, welche Urteile, Rechtsmittel und Anordnungen es erlässt?
Das Gericht ist nicht befugt, mehr zu gewähren, als von den Parteien ausdrücklich beantragt wurde. (§ 405 ZPO). Ein Leistungsurteil ist nur zulässig, wenn die Forderung zum Zeitpunkt der Entscheidung fällig ist (§ 406 ZPO), außer in Fällen wie Unterhalt, wo auch zukünftige Verpflichtungen einbezogen werden können. Die Art des Urteils (z. B. Leistungs-, Feststellungs- oder Gestaltungsurteil) hängt von der Art des Anspruchs und dem Klagebegehren ab.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Beweismittel
Wie wird mit Zeugen-, Urkunden- und Sachverständigenbeweisen umgegangen?
Zeugenaussagen werden während des Verfahrens mündlich gemacht und vom Richter geleitet. Das Gericht stellt in erster Linie die Fragen, und die Anwälte dürfen nur ergänzende Fragen an die Zeugen stellen. Es gibt keine schriftlichen Zeugenaussagen oder Kreuzverhöre im gemeinrechtlichen Sinne und auch kein Discovery-Verfahren, bei dem die Parteien vorab Dokumente austauschen. Die Zeugen sind gesetzlich verpflichtet, zu erscheinen, auszusagen und einen Eid abzulegen. Ihre Glaubwürdigkeit wird vom Gericht nach freier richterlicher Überzeugung beurteilt, wobei Faktoren wie Auftreten, Konsistenz und Plausibilität berücksichtigt werden. Da es keine schriftlichen Aussagen gibt und die Kontrolle der Parteien begrenzt ist, haben die Anwälte weniger taktische Mittel, um Zeugenaussagen zu beeinflussen, anders als in Common-Law-Systemen, in denen die Vorbereitung von Zeugen eine große Rolle spielt.
Obwohl in Österreich der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt, können bestimmte Beweisarten ein höheres Beweisgewicht haben. Gemäß §§ 292-294 ZPO stellen amtliche Dokumente einen Vollbeweis dar und gelten als authentisch, was jedoch widerlegt werden kann.
Der Beweiswert von Sachverständigengutachten ist nicht speziell geregelt und unterliegt daher ebenfalls der freien Würdigung durch das Gericht. In der Praxis können sie jedoch in kommerziellen oder technischen Fällen von großer Bedeutung sein, wenn der Sachverhalt kompliziert ist und die Kenntnisse des Gerichts übersteigt. Die Sachverständigen werden vom Gericht ernannt, was die Möglichkeiten der Parteien einschränkt, die Auswahl der Sachverständigen taktisch zu nutzen. Wenn die Parteien private Sachverständigengutachten einreichen wollen, werden diese als private Dokumente behandelt und entsprechend gewertet.
In taktischer Hinsicht bietet das österreichische System weniger Möglichkeiten für den strategischen Einsatz von Beweisen, da der Richter die Präsentation und Bewertung der Beweise weitgehend kontrolliert. Im Vergleich zu mündlichen Beweisen liefern Urkundenbeweise oft stärkere und zuverlässigere Beweise, während mündliche Zeugenaussagen anfälliger für subjektive Interpretationen und Glaubwürdigkeitsbedenken sein können.
Recht erklärt - 30. Juli 2025
Wie geht das Gericht mit großen Mengen an kommerziellen oder technischen Beweisen um?
Die österreichischen Gerichte behandeln komplexe oder technische Beweismittel hauptsächlich durch die Bestellung von Gerichtssachverständigen gemäß § 351 ZPO. Wenn es in einer Rechtssache um Fragen geht, die über das Fachwissen des Richters hinausgehen - wie Finanzanalysen oder Ingenieurwesen -, stützt sich das Gericht auf Sachverständigengutachten, um den Sachverhalt zu verstehen und zu bewerten.
Die Gerichte nutzen auch vorbereitende Verhandlungen (§ 258 ZPO), um den Fall zu organisieren und sich frühzeitig auf wichtige Fragen zu konzentrieren. In Wien werden Handelssachen häufig vor dem Handelsgericht Wien verhandelt, das Erfahrung im Umgang mit großen Wirtschaftsstreitigkeiten hat.
Digitale Tools wie der Elektronische Rechtsverkehr (ERV) helfen dabei, große Mengen an Dokumenten effizient zu verwalten und auszutauschen.
Recht erklärt - 30. Juli 2025
Kann ein Zeuge in Ihrem Land gezwungen werden, vor einem ausländischen Gericht auszusagen? Und kann ein Gericht in Ihrem Land einen ausländischen Zeugen zwingen, auszusagen?
Nach österreichischem Recht ist die unmittelbare Erzwingung von Zeugenaussagen vor ausländischen Gerichten oder durch ausländische Behörden aufgrund der Grundsätze der staatlichen Souveränität und des etablierten Rahmens der internationalen justiziellen Zusammenarbeit grundsätzlich nicht zulässig. Stattdessen müssen ausländische Gerichte ein formelles Rechtshilfeersuchen an das zuständige österreichische Gericht stellen.
Die ausländische Beweisaufnahme ist in multilateralen und bilateralen Verträgen und EU-Verordnungen geregelt. Österreich ist nicht Vertragspartei des Haager Beweisrechtsübereinkommens von 1970.
Wenn der Zeuge seinen Wohnsitz in Österreich hat, kann das ausländische Gericht ihn nicht direkt vorladen oder zur Aussage zwingen. Stattdessen wird der Antrag auf dem Dienstweg übermittelt, und das österreichische Gericht führt die Beweisaufnahme nach österreichischem Verfahrensrecht durch. Zwangsmaßnahmen (z. B. Geld- oder Haftstrafen) können nur angewandt werden, wenn das österreichische Gericht für den Zeugen zuständig ist - in der Regel, weil er in Österreich wohnt, die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder ausreichende Verbindungen zu Österreich hat. Besteht keine solche Verbindung, kann der Zeuge nur freiwillig aussagen, und die österreichischen Behörden können die Einhaltung der Vorschriften nicht erzwingen.
291a der österreichischen ZPO regelt die Beweisaufnahme im Ausland durch österreichische Gerichte. Wenn die formellen Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein österreichisches Gericht selbst eine Beweisaufnahme im Ausland durchführen oder an einer Beweisaufnahme durch eine ausländische Behörde teilnehmen. Solche Maßnahmen sind jedoch nur unter strengen Voraussetzungen zulässig: Sie müssen ausnahmsweise notwendig und völkerrechtlich zulässig sein, mit angemessenen Reise- und Logistikkosten verbunden sein und die Zustimmung des ausländischen Staates erfordern. Die Initiative für ein solches Verfahren muss von einer Partei ausgehen; das Gericht kann nicht von Amts wegen tätig werden, außer in Fällen, die dem Untersuchungsgrundsatz unterliegen (typischerweise in Verfahren, in denen ein öffentliches Interesse auf dem Spiel steht, wie z.B. in bestimmten familienrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten).
Umgekehrt können die österreichischen Gerichte einen ausländischen Zeugen nicht zwingen, im Ausland auszusagen. Stattdessen müssen sie ein Rechtshilfeersuchen an die ausländische Behörde richten, die dann die Beweiserhebung nach ihrem eigenen nationalen Recht durchführen kann. Österreichische Gerichte sind nicht befugt, einen Zeugen außerhalb des österreichischen Hoheitsgebiets direkt vorzuladen oder zu bestrafen.
Im EU-Kontext erleichtert die Verordnung (EU) Nr. 1206/2001 (EU-Beweisverordnung) die grenzüberschreitende Beweisaufnahme innerhalb der Mitgliedsstaaten und ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit. Sie ermöglicht es einem österreichischen Gericht, ein ausländisches Gericht innerhalb der EU (mit Ausnahme Dänemarks) direkt um Beweismittel zu ersuchen, und erlaubt es österreichischen Gerichten unter bestimmten Voraussetzungen, Beweise direkt in einem anderen Mitgliedstaat aufzunehmen. Solche Verfahren unterliegen jedoch nach wie vor der Zustimmung des ausländischen Staates und den Beschränkungen, die durch dessen nationales Recht auferlegt werden.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Wie werden Zeugen- und Urkundenbeweise im Vorfeld und während der Verhandlung geprüft? Ist ein Kreuzverhör zulässig?
Zeugenaussagen werden in erster Linie während der Verhandlung durch mündliche Zeugenaussagen unter Leitung des Richters geprüft. Das Gericht stellt die Fragen, und die Anwälte dürfen nur ergänzende Fragen stellen; ein förmliches Kreuzverhör, wie es in Common-Law-Systemen üblich ist, ist jedoch nicht zulässig. Vor der Verhandlung gibt es kein Offenlegungsverfahren und keinen Austausch von schriftlichen Zeugenaussagen. Zeugen sind verpflichtet, unter Eid auszusagen, und das Gericht beurteilt ihre Glaubwürdigkeit nach freier richterlicher Überzeugung.
Offizielle Dokumente gelten als authentisch und haben volle Beweiskraft, sofern sie nicht angefochten werden. Private Dokumente, einschließlich privater Sachverständigengutachten, die von den Parteien vorgelegt werden, werden ebenfalls berücksichtigt, unterliegen aber der freien Bewertung des Gerichts ohne Echtheitsvermutung.
Insgesamt stützt sich die Beweisprüfung in Österreich stark auf die aktive Rolle des Richters, wobei es kein Kreuzverhör im kontradiktorischen Stil gibt, was den inquisitorischen Charakter des Verfahrens widerspiegelt.
Recht erklärt - 30. Juli 2025
Welche Möglichkeiten gibt es, Beweise von Dritten zu erheben?
Hinsichtlich der Aufbewahrung von Dokumenten im Rahmen des Gerichtsverfahrens haben die Parteien das Recht, der Vorlage von Beweismitteln zu widersprechen, wenn es sich um Familienangelegenheiten, die Pflicht der Partei, die eigene Person oder Dritte vor strafrechtlicher Verfolgung zu schützen, das Anwaltsgeheimnis oder Geschäftsgeheimnisse handelt.
Hat eine Partei jedoch im Verfahren auf das Beweismittel Bezug genommen oder bestehen materiell-rechtliche Voraussetzungen für dessen Offenlegung, muss sie es vorlegen. Darüber hinaus dürfen Dokumente, die von den Parteien gemeinsam genutzt werden, wie z. B. ein schriftlicher Vertrag, nicht zurückgehalten werden.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Zeitlicher Rahmen
Wie lange dauern die Verfahren in der Regel, und unter welchen Umständen können sie beschleunigt werden?
Die Dauer der erstinstanzlichen Verfahren kann sehr unterschiedlich sein. Im Durchschnitt dauert es etwa ein Jahr, bis ein Fall abgeschlossen ist, obwohl komplexe Streitfälle auch viel länger dauern können. Über Berufungen wird in der Regel innerhalb von etwa sechs Monaten entschieden.
Recht erklärt - 30. Juli 2025
Einen Vorteil erlangen
Welche anderen Schritte kann eine Partei während des Verfahrens unternehmen, um einen taktischen Vorteil in einem Fall zu erzielen?
Wenn der Beklagte nicht rechtzeitig auf eine Klage antwortet, kann der Kläger den Erlass eines Versäumnisurteils beantragen, und die Entscheidung wird auf der Grundlage der verfügbaren Beweise getroffen. Ein Versäumnisurteil kann auch von jeder Partei beantragt werden, wenn die gegnerische Partei einen anberaumten Termin ohne triftigen Grund versäumt (§ 396 ZPO). Dies ermöglicht es dem Gericht, zugunsten der anwesenden Partei zu entscheiden, ohne den gesamten Sachverhalt zu prüfen.
Eine Partei kann verfahrensrechtliche Einwendungen wie Unzuständigkeit, Rechtshängigkeit (anhängige Parallelverfahren) und Rechtskraft (bereits entschiedene Angelegenheiten) geltend machen. Diese Einwände können zu einer vorzeitigen Einstellung des Verfahrens ohne Verhandlung führen, wenn ihnen stattgegeben wird.
Obwohl das österreichische Recht das anglo-amerikanische Konzept der Streichung von Teilen eines Falles als formales Instrument nicht verwendet, kann eine Partei beantragen, dass unzulässige Behauptungen oder Beweise außer Acht gelassen werden (z. B. weil sie irrelevant oder unzureichend begründet sind) oder dass bestimmte Schriftsätze ignoriert werden, wenn sie gegen Verfahrensvorschriften verstoßen (z. B. nicht rechtzeitig eingereicht wurden).
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Auswirkungen der Finanzierung durch Dritte
Welche Auswirkungen kann es auf den Rechtsstreit haben, wenn Dritte die Kosten des Rechtsstreits finanzieren und nachteilige Kosten übernehmen können?
Die Finanzierung durch Dritte ermöglicht es Parteien, ein Gerichtsverfahren einzuleiten, die ansonsten nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um sich einen Rechtsstreit zu leisten.
In Österreich gibt es keine spezifischen gesetzlichen Bestimmungen zur Drittmittelfinanzierung. Die Drittmittelfinanzierung ist in der Praxis akzeptiert und wurde 2013 vom österreichischen Obersten Gerichtshof bestätigt (6 Ob 224/12b). Sie steht sowohl Klägern als auch Beklagten zur Verfügung und kann in allen Arten von Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Schiedsverfahren, in verschiedenen zivil- und handelsrechtlichen Streitigkeiten genutzt werden. Allerdings gibt es Einschränkungen, wenn ein Rechtsanwalt als Drittfinanzierer auftritt, da das österreichische Recht es Rechtsanwälten verbietet, ausschließlich auf Erfolgshonorarbasis zu arbeiten (quota litis-Verbot). Vereinbarungen, die einen Wucher darstellen - Ausbeutung einer bedürftigen Person - sind gemäß Artikel 1 des Gesetzes gegen Wucher nichtig. Während des gesamten Prozessfinanzierungsverfahrens muss der Rechtsanwalt stets seine Unabhängigkeit wahren, wie im österreichischen Rechtsanwaltsgesetz festgelegt.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Auswirkungen der Technologie
Welchen Einfluss hat die Technologie auf komplexe Handelsstreitigkeiten in Ihrer Gerichtsbarkeit?
Wie in § 277 ZPO festgelegt, können österreichische Gerichte Videokonferenzen bei der Beweisaufnahme einsetzen. Diese Methode wird als gleichwertig mit einer persönlichen Verhandlung angesehen und ermöglicht die Vernehmung sowohl der Parteien als auch von Zeugen. Diese Bestimmung räumt den Parteien jedoch nicht das Recht ein, eine Vernehmung per Videokonferenz zu beantragen, da die Entscheidung darüber im Ermessen des Gerichts liegt, das dabei auch Überlegungen zur Effizienz des Verfahrens berücksichtigt.
Österreich verfügt auch über ein elektronisches Rechtsverkehrssystem (ERV), das es den Angehörigen der Rechtsberufe und den Gerichten ermöglicht, Dokumente auf elektronischem Wege einzureichen und zu empfangen, ohne dass eine Papierspur entsteht. Das System ist gut in das österreichische Zivilverfahren integriert und wird von Rechtsanwendern und Gerichten weitgehend genutzt.
Derzeit gibt es keine gesetzliche Regelung für die technologiegestützte Dokumentenprüfung bei Gericht.
Gesetz angekündigt - 30. Juli 2025
Parallele Verfahren
Wie werden Parallelverfahren gehandhabt? Welche Maßnahmen kann eine Partei ergreifen, um sich unter diesen Umständen einen taktischen Vorteil zu verschaffen, und kann eine Partei Privatklage erheben?
Zivilverfahren können gemäß § 190 ZPO ausgesetzt werden, wenn der Ausgang des Verfahrens von anderen parallelen Verfahren, wie Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, abhängt.
Bestimmte Straftaten, die im Gesetz ausdrücklich definiert sind, unterliegen nach österreichischem Recht der Privatanklage. Diese Privatanklagedelikte werden nur auf Antrag des Opfers verfolgt (z.B. Verleumdung, Beleidigung, Kredit- oder Rufschädigung, falsche Anschuldigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Verletzung des Fernmeldegeheimnisses). Aus taktischen Gründen kann eine Partei eine entsprechende Strafanzeige erstatten oder betonen, um ihre zivilrechtliche Position zu stärken, insbesondere bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Betrug, Veruntreuung oder Korruption.
Österreichische Zivilgerichte sind nicht automatisch an Feststellungen von Regulierungsbehörden (z.B. Wettbewerbs- oder Finanzaufsichtsbehörden) gebunden, doch können solche Entscheidungen Beweiskraft haben. Eine Partei kann die Feststellungen einer Aufsichtsbehörde in einem Zivilverfahren als Tatsachengrundlage verwenden.
In bestimmten Fällen können sich die Parteien einen taktischen Vorteil verschaffen, indem sie parallele Straf- oder Regulierungsverfahren einleiten oder sich auf diese stützen, insbesondere wenn die Feststellungen in diesen Verfahren die Bewertung des Sachverhalts oder die rechtlichen Schlussfolgerungen des Zivilgerichts beeinflussen können. Die Gerichte verfügen jedoch über einen Ermessensspielraum bei der Entscheidung, ob eine Aussetzung angemessen ist, wobei sie die Verfahrensökonomie und Fairness berücksichtigen.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Gerichtsverfahren
Ablauf der Verhandlung
Wie wird die Verhandlung bei den üblichen Arten von Handelsstreitigkeiten geführt? Wie lange dauert die Verhandlung in der Regel?
Handelsrechtliche Streitigkeiten werden in Österreich von Berufsrichtern geführt und folgen einem mündlichen, öffentlichen Verfahren. Nach einer schriftlichen Phase, in der der Kläger die Klageschrift einreicht und der Beklagte antwortet, hält das Gericht eine Vorverhandlung ab, um Fragen zu klären und einen Zeitplan festzulegen. In der Hauptverhandlung werden Beweise, einschließlich Zeugen und Sachverständigengutachten, vorgelegt. Einfache Fälle können innerhalb von sechs bis 12 Monaten abgeschlossen werden, komplexe Fälle können über 18 Monate dauern.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Einsatz von Geschworenen
Sind Schwurgerichtsverfahren die Regel, und können sie verweigert werden?
Nein, in Österreich gibt es keine Geschworenenprozesse in Zivilsachen. Geschworenenprozesse gibt es nur in sehr wenigen Strafsachen, Zivilverfahren werden jedoch ausschließlich von Richtern entschieden.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Vertraulichkeit
Wie wird die Vertraulichkeit behandelt? Können alle Beweismittel öffentlich zugänglich gemacht werden? Wie können sensible Geschäftsinformationen geschützt werden? Ist der Zugang der Öffentlichkeit zu den Gerichten gewährleistet?
In Österreich ist der Grundsatz, dass Zivil- und Strafverfahren öffentlich geführt werden müssen, in Artikel 90 der Verfassung verankert. Bestimmte Ausnahmen von diesem Grundsatz können jedoch per Gesetz eingeführt werden.
Nach der allgemeinen Vorschrift des § 171 der Zivilprozessordnung (ZPO) ist die Verhandlung, einschließlich der Verkündung der gerichtlichen Entscheidung, öffentlich. Es dürfen nur unbewaffnete Personen zugelassen werden; Minderjährigen kann der Zutritt verweigert werden, wenn ihre Anwesenheit geeignet ist, ihre persönliche Entwicklung zu gefährden.
Das Gericht kann die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausschließen, wenn die öffentliche Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet ist oder wenn die große Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Öffentlichkeit die Verhandlung stören oder die Tatsachenfeststellung behindern wird. Die Öffentlichkeit kann auch auf Antrag einer Partei ausgeschlossen werden, wenn es sich um Angelegenheiten des Familienlebens oder um Geschäftsgeheimnisse handelt (§ 172 ZPO).
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Medien und öffentliches Interesse
Wie wird mit dem Interesse der Medien umgegangen? Werden die Medien jemals angewiesen, über bestimmte Informationen nicht zu berichten? Sind Gerichtsverhandlungen öffentlich? Wie haben die Öffentlichkeit und die Medien Zugang zu Prozessen?
Das Interesse der Medien wird im Allgemeinen durch das Grundrecht auf Presse- und Meinungsfreiheit geschützt, das durch die österreichische Verfassung (Artikel 13 des Grundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger) und die Europäische Menschenrechtskonvention (Artikel 10 der EMRK) garantiert wird. Allerdings ist das Gericht befugt, dieses Recht unter bestimmten Umständen einzuschränken. Österreichische Gerichte können den Medien die Berichterstattung über bestimmte Informationen verbieten und tun dies auch, insbesondere wenn eine solche Berichterstattung das Recht auf Privatsphäre verletzen, die Fairness des Verfahrens gefährden oder im Widerspruch zu übergeordneten rechtlichen Schutzbestimmungen stehen würde. Diese Einschränkungen beruhen auf nationalem Recht und der Abwägung der Meinungsfreiheit mit anderen Grundrechten. Darüber hinaus sind Ton- und Bildaufnahmen in öffentlichen Gerichtsverhandlungen verboten.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025
Nachweis von Ansprüchen
Wie werden Geldforderungen bemessen und nachgewiesen?
In Österreich werden Geldforderungen nach der Art der rechtlichen Verpflichtung berechnet, in erster Linie nach dem österreichischen Bürgerlichen Gesetzbuch und der ZPO. Die Partei, die den Anspruch geltend gemacht hat, muss den geforderten Betrag ausreichend nachweisen. Darüber hinaus räumt § 273 ZPO dem Richter in Fällen, in denen Beweise für den strittigen Betrag oder die Forderung nur mit großem Aufwand erbracht werden können, einen Ermessensspielraum im Verfahren ein, indem er über die Höhe einer Forderung entscheiden kann, deren Berechtigung bereits feststeht.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Post-trial .
Kosten
Wie geht das Gericht mit den Kosten um? Wie sind die Urteile in komplexen Handelssachen in der Regel aufgebaut und wie lang sind sie, und sind sie öffentlich zugänglich?
Das Gericht entscheidet über Prozesskosten, Anwaltsgebühren und Zinsansprüche. Der Zinssatz richtet sich in der Regel nach dem für die Hauptforderung geltenden Recht. Widerspricht der anzuwendende Zinssatz jedoch der österreichischen öffentlichen Ordnung, wird er nicht vollstreckt. Österreichische Gerichte rechnen zugesprochenen Schadenersatz bei der Anerkennung ausländischer Urteile nicht in Euro um; die Währungsumrechnung erfolgt stattdessen in der Vollstreckungsphase.
Nach österreichischem Recht trägt gemäß § 41 Abs. 1 ZPO grundsätzlich die Partei, die den Prozess verliert, die Prozesskosten. Eine Rückerstattung der Gerichts- und Anwaltskosten ist nur möglich, wenn der Rechtsstreit angefochten wird.
In Österreich sind die Urteile in komplexen Handelssachen formal aufgebaut und enthalten die Entscheidung, den Sachverhalt, die Begründung und die Kostenentscheidung. Ihr Umfang hängt von der Komplexität des Falles ab und reicht oft von 20 bis über 100 Seiten. Während die Urteile der unteren Instanzen nicht öffentlich zugänglich sind, werden ausgewählte Entscheidungen der höheren Instanzen (insbesondere des Obersten Gerichtshofs) anonymisiert und auf offiziellen Plattformen wie RIS veröffentlicht.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Rechtsbehelfe
Wann können Urteile angefochten werden? Wie viele Instanzen gibt es und wie lange dauern Berufungen in der Regel?
In Österreich gibt es zwei Rechtsmittelinstanzen:
- Berufung gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz sowohl aus tatsächlichen als auch aus rechtlichen Gründen; und
- Berufung an den Obersten Gerichtshof (Revision) - nur in Rechtsfragen und wenn die Frage von allgemeinem rechtlichem Interesse ist.
Die Berufungsfrist beträgt in der Regel vier Wochen ab der Zustellung des Urteils. Berufungen in der ersten Instanz werden in der Regel innerhalb von sechs bis 12 Monaten entschieden, während Berufungen an den Obersten Gerichtshof länger dauern können, je nach Komplexität oft ein Jahr oder länger.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Vollstreckbarkeit
Wie vollstreckbar sind die Urteile der Gerichte Ihres Landes international?
Österreichische Urteile sind in der Regel weltweit vollstreckbar. Für EU-Länder außer Dänemark gibt es ein vereinfachtes Vollstreckungsverfahren nach der Brüsseler Regelung, das kein gesondertes Anerkennungsverfahren erfordert. Ein in einem Mitgliedsstaat ergangenes Urteil ist in einem anderen Mitgliedsstaat vollstreckbar.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Wie unterstützen die Gerichte in Ihrem Land die Vollstreckung ausländischer Urteile?
Die Gerichte wenden die Vorschriften des einschlägigen internationalen Rechtsinstruments an, z. B. die Brüsseler Regelung, das Luganer Übereinkommen, das Haager Übereinkommen oder anwendbare bilaterale Abkommen. Unterliegt die ausländische Entscheidung keiner Sonderregelung, entscheiden die Gerichte über die Vollstreckbarkeit nach dem österreichischen Vollstreckungsgesetz (AEA), das folgende Voraussetzungen vorsieht (406-407 AEA):
- Das Urteil muss in dem Staat, in dem es ergangen ist, vollstreckbar sein.
- Die Gegenseitigkeit ist durch völkerrechtliche Verträge oder innerstaatliche Vorschriften gewährleistet.
- Die ausländische Behörde, die das Urteil erlassen hat, war nach Normen zuständig, die mit dem österreichischen Recht vergleichbar sind.
- Die Bekanntmachung des Verfahrens wurde ordnungsgemäß zugestellt.
- Das Urteil unterliegt nicht einem Rechtsweg, der die Vollstreckbarkeit nach dem anzuwendenden Recht verhindert.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Sonstige Erwägungen
Interessante Merkmale
Gibt es besonders interessante Merkmale oder taktische Vorteile eines Prozesses in diesem Land, die in den vorherigen Fragen nicht angesprochen wurden?
Nicht zutreffend.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Nachteile des Gerichtsstandes
Gibt es besondere verfahrensrechtliche oder pragmatische Nachteile eines Rechtsstreits in Ihrem Land?
Es gibt keine solchen Nachteile.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Besondere Erwägungen
Gibt es besondere Erwägungen, die bei der Verteidigung einer Klage in Ihrem Rechtsraum zu berücksichtigen sind und die in den vorherigen Fragen nicht angesprochen wurden?
Nicht zutreffend.
Erklärtes Recht - 30. Juli 2025
Aktualisierung und Trends
Die wichtigsten Entwicklungen des vergangenen Jahres
Welches waren die wichtigsten Fälle, Entscheidungen, Urteile und politischen und legislativen Entwicklungen des vergangenen Jahres?
Gesetzgeberische Entwicklungen
Eine der wichtigsten gesetzgeberischen Entwicklungen des vergangenen Jahres ist die EU-Richtlinie 2020/1828 (Richtlinie über Vertretungsklagen), die in Österreich mit fast zweijähriger Verspätung am 18. Juli 2024 in Kraft getreten ist. Die Richtlinie wurde durch die "VRUN-Novelle" in österreichisches Recht umgesetzt und schafft einen Rahmen für kollektive Rechtsdurchsetzung. Die wichtigsten Punkte dieser neuen Richtlinie werden im Folgenden erläutert.
Ein zentraler Bestandteil dieser Reform war die Einführung des Gesetzes über qualifizierte Einrichtungen für kollektive Rechtsdurchsetzung (QEG). Als "qualifizierte Einrichtungen" gelten nach diesem Gesetz alle österreichischen Organisationen, die in der Vergangenheit berechtigt waren, kollektive Rechtsansprüche in Form von Unterlassungsklagen geltend zu machen. Das Gesetz umreißt auch die Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit andere Organisationen von der Bundeskartellbehörde als "qualifizierte Einrichtungen" eingestuft werden können. Die Voraussetzungen, um als qualifizierte Einrichtung für grenzüberschreitende Verbandsklagen zu gelten, sind wie folgt (§ 1 Abs. 1 QEG)
- ist bereits vor der Antragstellung seit 12 Monaten zum Schutz der Verbraucherinteressen tätig und hat ein berechtigtes Interesse am Schutz der Verbraucherinteressen;
- nicht gewinnorientiert ist;
- nicht in Konkurs gegangen ist oder ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet wurde;
- unabhängig ist und nicht unter dem Einfluss von Personen - mit Ausnahme von Verbrauchern - steht, insbesondere von Gewerbetreibenden, die ein wirtschaftliches Interesse an der Erhebung einer Verbandsklage haben, auch im Falle der Finanzierung durch Dritte, und über entsprechende Verfahren verfügt, um eine solche Einflussnahme und Interessenkonflikte zwischen dem Antragsteller, seinen Geldgebern und den Verbraucherinteressen zu vermeiden, und
- in geeigneter Weise, insbesondere auf ihrer Website, in klarer und verständlicher Sprache Informationen öffentlich zugänglich machen, aus denen hervorgeht, dass sie die unter den Nummern 1 bis 4 genannten Kriterien erfüllen, sowie Informationen über ihre Finanzierungsquellen im Allgemeinen, ihre Organisations-, Verwaltungs- und Mitgliederstruktur, ihren Satzungszweck und ihre Tätigkeiten.
Neben den vorgenannten Anforderungen müssen zwei weitere erfüllt sein, um als qualifizierte Einrichtung für inländische Vertretungshandlungen zu gelten (§ 2 Abs. 1 QEG):
- sie muss aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit und ihrer sachlichen, personellen und finanziellen Ausstattung sicher erscheinen, dass sie ihre satzungsgemäßen Aufgaben auch in Zukunft wirksam und angemessen erfüllen wird; und
- sie nicht mehr als 20 Prozent ihrer finanziellen Mittel aus Spenden, unentgeltlichen Zuwendungen oder Schenkungen bezieht.
Insbesondere ist das Handelsgericht Wien für diese Sammelverfahren ausschließlich zuständig.
Eine wichtige Entscheidung, die Österreich bei der Umsetzung der VRUN getroffen hat, ist die Einführung eines "Opt-in"-Modells für kollektive Rechtsschutzverfahren. Das bedeutet, dass sich die Verbraucher für eine Sammelklage "entscheiden" müssen (in der Regel innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe im Amtsblatt), um an der Sammelklage teilzunehmen. Im Gegensatz zu Opt-out-Modellen (bei denen alle betroffenen Verbraucher automatisch einbezogen werden, es sei denn, sie widerrufen) wird bei diesem System die Entscheidung des Einzelnen respektiert, auch wenn dies zu einer kleineren Gruppengröße führen kann. Damit eine Sammelklage eingereicht werden kann, muss die qualifizierte Einrichtung nachweisen, dass mindestens 50 Verbraucher von dem mutmaßlichen Verstoß betroffen sind. Die qualifizierte Einrichtung kann eine Gebühr erheben, die jedoch auf 250 € oder 20 % des geltend gemachten Betrags (je nachdem, welcher Betrag niedriger ist) begrenzt ist.
Nach § 6 Absatz 1 QEG ist auch die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten durch Dritte zulässig, allerdings unter den folgenden Voraussetzungen
- der Drittmittelgeber darf weder ein Wettbewerber des beklagten Unternehmens sein, noch darf er von diesem wirtschaftlich oder rechtlich abhängig sein; und
- die Entscheidungen der qualifizierten Einrichtung in dem Verfahren dürfen durch den Drittfinanzierer nicht zum Nachteil der Verbraucher unangemessen beeinflusst werden.
Die oben genannten Einschränkungen dienen der Vermeidung von Interessenkonflikten.
Insgesamt stellen die oben erörterten wesentlichen Änderungen einen bedeutenden Wandel in der Handhabung von kollektiven Rechtsbehelfen dar und verbessern die kollektive Streitbeilegung in Österreich. Die VRUN und das QEG schaffen zusammen einen besser strukturierten und leichter zugänglichen Rahmen für die Rechtsverfolgung von Verbrauchern, insbesondere in Fällen, in denen eine individuelle Rechtsverfolgung unpraktisch wäre. Darüber hinaus bringen die Reformen das österreichische Rechtssystem in Einklang mit der EU-Richtlinie über repräsentative Maßnahmen und stärken so den Verbraucherschutz.
Reform der Streitbeilegung
Nach den Nationalratswahlen im September 2024 gab es in Österreich eine verlängerte Koalitionsverhandlungsphase von fast fünf Monaten. Am 3. März 2025 wurde die Regierung Stocker als Regierung von Österreich vereidigt. In der Zwischenzeit war die gesetzgeberische Tätigkeit begrenzt und es wurden keine neuen Reformen im Bereich der Streitbeilegung ausgearbeitet. Auch seit der Bildung der neuen Regierung gab es keine weiteren Gesetzesinitiativen zur Streitbeilegung.
Erklärtes Gesetz - 30. Juli 2025